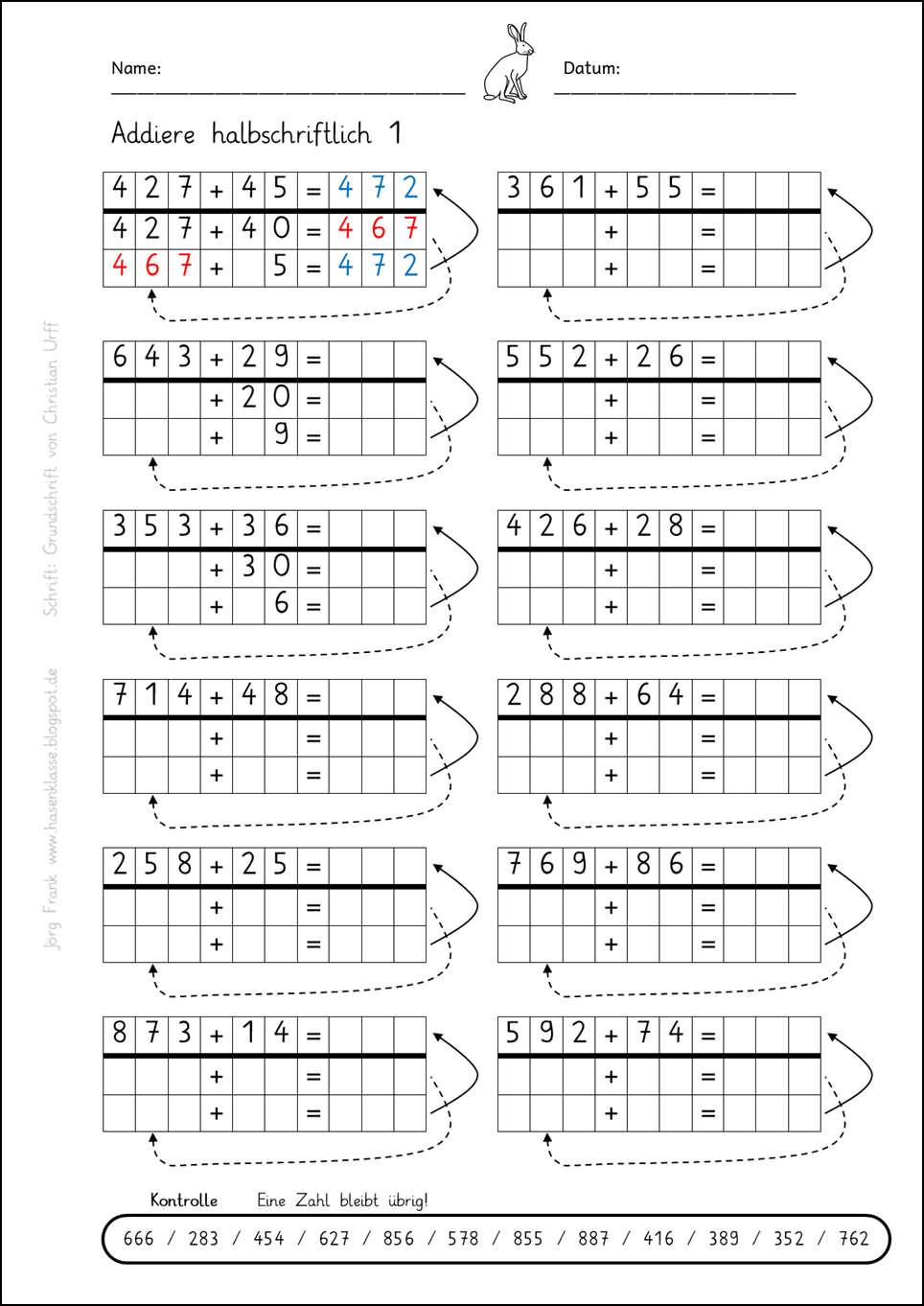Ich geb’s ja zu: Ich hätte das Album vermutlich gar nicht angehört, hätte David Bowie nicht den Übergang vollzogen.
Ein schweres Versäumnis wäre das gewesen – eine abschließende Vision als Hinterlassenschaft von Gewicht mir entgangen. Bowie zeigt Wege auf hinaus dem „Meta“, ohne dabei der berühmten „falschen Unmittelbarkeit“ zu erliegen.
Springt mitten hinein ins Erforschen des Seins und seinem Sich-Ereignen in Klängen, Sprache und (Sprach-)Bildern in all ihrer Historizität. Das Werden zelebriert sich als Vergehen, aus dem das Neue aufscheint, so in etwa kann das „Blackstar“-Album gehört werden, und so plump diese Message scheint, ihre Durchführung geht tief unter die Haut– das Album taucht ein in die Vielfalt menschlicher Möglichkeiten und hat als Single nicht zufällig „Lazarus“ gewählt: Eine der rätselhaftestes Figuren in der biblischen Mythologie. Wird doch nicht zuletzt im apokryphen, hochumstrittenen und „geheimen“ Markusevangelium folgendes formuliert:
Und das, nachdem er von Jesus von den Toten auferweckt worden sei.
Mythen leben von ihrer Interpretierbarkeit. Dass Bowie, selbst Mythos im Rahmen der populären Kultur, einen solch musikalisch schillernden Abgang sich wählte und ihn noch symbolträchtig im Video visualisierte: Es zeigt den Hörenden, dass die unendliche Ausdeutbarkeit der Geschichten von Tod und Auferstehung eben keinesfalls nur buchstäblich zu lesen ist.
Die Möglichkeit, Unendlichkeit im Spiel mit der Interpretation ohne Gewichtsverlust des Interpretierten zu erkunden, zeigen auch die mit allerlei assoziationsreichen Aufladungen versehenen Versatzstücke, aus denen der Text zum Titelsong sich formt.
Gangstar, Popstar, Blackstar: Die überbordenden Verstehensversuche der Lyrics im Netz reichen von IS-Bezügen im Titelsong (das wurde offiziell dementiert) bis hin zu gnostischen und okkulten Anspielungen, von der Behauptung des Spiels mit Aleister Crowley bis hin zur recht profanen Sicht, Bowie habe sich vor allem mit dem bevorstehenden Tode beschäftigt. All die hermeneutischen Mühen mögen wohl vor allem belegen, dass gelungene Vieldeutigkeit in den Interferenzonen zwischen Sprache, Bild und und Klangfolgen situiert sich entfaltet. Letztlich sind es über den musikalischen Dialog hinweg schwebende Beschwörungen Bowies, die sich offenbaren in ihrer unmöglichen Fixierbarkeit. Der Blackstar ist kein Fixstern.
So wurde zurecht gegen die Festlegung der Interpretation auf eine Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod Bowies eingewandt, dass eine solche Sicht, die das Thematisieren des endgültigen Endes eines Künstlerkörpers aus dem Werk heraus liest, das Wirken Bowies grob verkenne. Eine „Biographisierung“ verbiete sich bei einem, der so nachhaltig vermeintliche Erdungen im Rockismus vermied und solchen Fantastereien die Zeichendichte und den Wandel entgegen setzte.
Seine Meisterschaft liegt im Spiel mit Codes, so daß die Musik selbst manches Mal fast in den Hintergrund trat und im Visuellen und Performativen aufging.
Noch da, wo zu Beginn des annähernd überfrachteten Films zum Titelsong des Albums der Astronaut in der Kulisse liegt und alle Anspielungen von ” Major Tom” bis hin zur Ersatzreligion der Kinder in “Jenseits der Donnerkuppel”; vom esoterischen Mythos, Außerirdische hätten einst menschliche Zivilisationen angeregt und initiiert bis hin zum Tod (der Schädel wird dem Astronautenhelm im folgenden entnommen und zum Kult-Gegenstand), ist es das Multiple des Verweises und dessen Unauflöslichkeit, die düster leuchtet. Und das zu einem Text, der auf altnordische Mythologie anspielt. Es ist gerade diese Verdichtung von Referenzen, die das Album und seine Visualisierung so unergründlich faszinierend in den Pop einschreibt als letztem Wurf von Bowies Erbe.
Zum Zeitpunkt der Aufnahmen sei viel Kendrick Lamars “To Pimp a Butterfly” von allen Beteiligten gehört worden, so berichten die Quellen aus den Untiefen des Internets. Ein Album, auf dem auch der allseits zu recht gehypete Kamasi Washington mitwirkte – er schuf mit “The Epic” fast eine Art lustvoll-enzyklopädischer Herangehensweise an Quellen der Black Musics im Plural im Rahmen monumentalfilmhafter, politisch gewichtiger und einfach nur gewaltiger Passagen und verband sie mit seinem Saxophonspiel.
Auch das scheint an Bowie und seinem Produzenten nicht spurlos vorüber gegangen zu sein; es ist verblüffend, wie Bowie seinen brüchig-hymnischen Gesang über ein ausdifferenziertes, fast undurchschaubares Sound-Bett erhebt, so dass Analysen – welche Art von Beat? Was sind das für Harmonien? – gar nicht treffen können, was als Fusion die Neugier des Ohres auch beim mehrfachen Hören reizt.
Viele der Besprechungen zerlegen das Gehörte, es so verfehlend, in einzelne Module – mit Nelson Goodman die Dichte eines Werkes als Kriterium für Gelungensein begreifend, ist es dies, gelungen eben, und es muss in seine flächige Raumzeitlichkeit eingetaucht werden. Um dann durch’s akustische Erfahren zu schwimmen und immer mal nach Luft zu schnappen.
Dieses Meer der Sounds gründet nachhaltig im Musikverständnis des das Bowie-Album mit prägenden Saxophonisten Donny McCaslin; jeder, der sich gerade für “Blackstar” erwärmt, sollte auch dessen Album “Fast Future” gehört haben. Es lohnt sich.
Eine eigentümlich visionäre Kombination aus Anklängen an die – obgleich zu recht von Kowo Eshun in “Heller als die Sonne” gefeiert – allseits verachtete Jazz-Fusion-Zeit der späten 60er und frühen 70er Jahre, als Herbie Hancock, Miles Davis und andere mit Funk und elektronischen Klängen experimentierten einerseits, und jenem Fortschreiben von Modern-Jazz-Motiven andererseits, das auch Joshua Redman z.B. erkundet.
Donny McCaslin spielt mit fast schon billigen Synthie- und Elektronik-Sounds und überlagert sie mit den verhalten ekstatischen Läufen – das kann mensch tatsächlich machen, gebremste Lust in Eleganz -, die nur das Saxophon ermöglicht. Er lässt – wie Washington – auch sphärische Chöre im Hintergrund wie Licht, das Töne erhebt, aufsteigen und stürzt sich in eine Rhythmik, die der Jazz hervor zu bringen vermag – das allerdings durch den Breakbeat und Jungle der 90er belehrt. Und garniert das ganze gewitzt mit Facebook-Signaltönen und Telefonaten mit der Liebsten.
3 der Musiker rund um McCaslin haben auf “Blackstar” mitgewirkt, mensch hört das deutlich. Und das Album ist nicht frei von Trickster-Witz – so posiert Bowie ja auch, auf einmal grinsend und verspielt mit Hüftschwung im Kurzfilm zum Titelsong. Nachdem – oder bevor? muss ich noch mal gucken – bereits Gekreuzigte, inszeniert wie Vogelscheuchen aus dem Horror-Film, das gleiche taten.
Dass Bowie nun ausgerechnet auf jene Musik, Fusion-Jazz, zurückgreift und sie modifiziert, so dass es zu ihm passt, jene Klänge also, die so viele in der Velvet Underground-Tradition sich Bewegenden hassten wie die Pest (ein dramatisches Zeugnis davon legt Lester Bangs, einst gefeierter Musikjournalist, in einem absurden Interview mit Lou Reed ab, das mit Gegeifer über Herbie Hancock sich blamiert – Lou Reed hörte den natürlich, und nachlesen kann mensch das in “Psychotische Reaktionen und heiße Luft”, eine Sammlung von Bangs-Texten) – auch das birgt eine pophistorische Ironie in sich, die nicht wie so viele derer Varianten seit den 90ern einfach nur verlachen will, sondern spielt, statt drüberzustehen.
Es ist grandios zu hören, wie sich Bowie eher über als in dem Bett der Sounds und Klänge bewegt als stimmlicher Flusslauf, der Fülle bereits hinter sich ließ – um doch immer wieder hinab zu steigen und in einen direkten Dialog mit dem Saxophon zu treten. Ein Instrument, das bereits auf dem “Young Americans”-Album eine gewichtige Rolle spielte.
Der sehr geschätzte Jan Freitag lästert darüber in “Die Zeit” (wieso die Überschrift noch Michael Jackson einen verpassen muss, bleibt ein Geheimnis), laut.de fühlt sich an “Careless Whisper” erinnert und dadurch genervt – doch wie immer, wenn Menschen gegen “Wham!” schießen (auch die ohne Bowie undenkbar), wird irgendetwas richtig gemacht.
Es ist faszinierend zu hören, wie dieses Saxophon als Dialogpartner dem fast schon düster und spooky und höchst kryptisch, doch eindringlich predigenden Bowie dient. Passagenweise ist das ein wenig gebaut wie in der Matthäus-Passion. Eben dann, wenn die Instrumental-Solisten im Bach-Werk mit dem Gesang in das Spiel rund um “Call and Response” eintreten und inmitten des Deklamierens der Passionsgeschichte plötzlich ein Spiel mit Beziehungen jenseits von reinen Codes entsteht: Weil Dialog so menschlich ist.
Kombiniert ist das mit der Religiösität und Mythos, Geschichte und Gegenwart vielfältig eben nicht reflektierenden, sondern IN deren Bildervielfalt sich bewegenden Texten, der Lust am Beschwören, und das mit Hilfe von Melodielinien, eingestreut, wie mensch sie vom ihm kennt – die Hörerin lauscht gebannt, wie das Zitierte aufbricht und in jene Uneindeutigkeit sich auflöst, die jedes Instrumentalisieren der Sujets unmöglich macht. Ja, sogar die ewige Wiederholung wie in einer Art Gebet scheint auf, freilich so, dass das Flehen und die Behauptung, dass es helfen könne, sich jeder konkreten Religion entzieht und stattdessen ganz dem Pop sich zuwendet. “I can’t give everything away” verkündet er, sich wiederholend – und dann erklingt auch da noch ein Widerhaken mit, der ganz dem plötzlichen Aufbrechen des Grinsens im Kurzfilm entspricht. Weil so viel Pathos eben nicht ungebrochen funktioniert.
All das ist so faszinierend, weil es IN DEN Bildern, den Sounds, den Klängen, den Dialogen mit McCaslin selbst sich verliert und findet, eine eigene Welt erschließt, die an den Rändern aufreißt und doch um den schwarzen Stern kreist, der dieses Album ist. Da ist bei allem Schweben nichts von Drübèrstehen, dem überheblich und gekonnt Zitieren zu spüren. Die Intensität entsteht aus dem Hineingehen in das vielfältige Material, ja, einem Sich-Ausliefern beinahe.
Das ist Hingabe. Hingabe an das Düstere, die Schattenreiche, vielleicht auch das nahende Ende – und dabei doch ebenso an das eigene Werk in seiner Geschichtlichkeit, um die eigene Ikonographie noch einmal kosmisch zu wenden und doch in der Zusammenarbeit mit den Jazzern deutlichst, wie eine Botschaft, über sie hinaus zu gehen.
In Ausdeutbarkeit und Ewigkeit – beinahe bin ich versucht, “Amen” zu schreiben. Übersetzt man dieses wie landläufig üblich mit “So sei es!”, dann ist der Ausruf passend: Es sei! Dieses Vermächtnis des überragenden Bowie. Es leuchtet uns wie ein schwarzer Stern in die musikalische Zukunft.